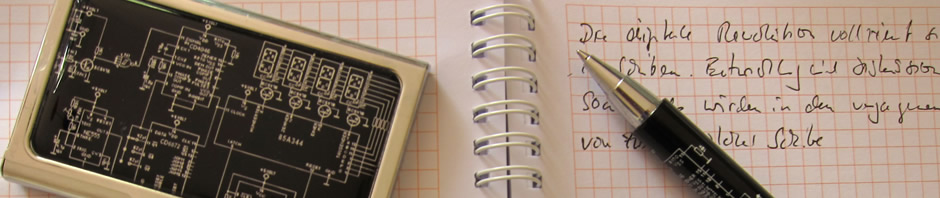Ob Corona im Herbst 2021 ausgestanden ist, lässt sich noch nicht abschliessend sagen. Manches spricht dafür und mit der Impfkampagne sind die spürbarsten Einschränkungen aus dem Alltag verschwunden.
Gesellschaftliche Folgen bzw. Auswirkungen lassen sich aber resumieren, zumindest einschätzen – nach gut anderthalb Jahren ist die Zeit dazu, Schlüsse zu ziehen. Übrigens auch auf der subjektiven Ebene der Empfindungen, wie ein Blick in die literarischen Neuerscheinungen in den Auslagen der Buchhandlungen zeigt.

Gleich zweimal wurden die Zukunftsannahmen aus den 2017 vorgestellten Szenarien von D 2030 auf ihre Gültigkeit überprüft. Zu Beginn der Pandemie und im Sommer 2021. Die letzten Auswertungen waren im September abgeschlossen. Grundlegende Fragestellung war Wie weit hat die Pandemie unsere Zukunftserwartungen beeinflusst?
Bei den Befragten zeigt sich ein deutlicher Wunsch nach einer Nachhaltigen Transformation (25) – bzw. der positiven Zukunftserwartung der Neue Horizonte – Szenarien. Im Vergleich zur frühen Phase der Pandemie fielen die Einschätzungen im Sommer 2021 dazu pessimistischer aus. Erlebt wurde oft eine schnelle Rückkehr zu alten Routinen, einer (manchmal) hohen staatlichen Lösungskompetenz steht ein Mangel an Teilhabe gegenüber. Deutlich werden Wertekonflikte zwischen konträren Positionen, wie etwa Digitalisierungsschub vs. Mangelhafte Digitalisierung; Corona hat Veränderungsfähigkeit gezeigt vs. Corona hat Beharrungstendenzen aufgezeigt (4).
Zu den zentralen Erfahrungen der Pandemie zählt, dass Ereignisse, die gesellschaftliche Änderungen in großem Maßstab zu Folge haben jederzeit möglich sind. Wer hätte etwa 2019 einen Lockdown für möglich gehalten? Erlebt wurden die Chancen, manchmal auch die Grenzen der Digitalisierung: flexibles, mobiles Arbeiten, Online- Konferenzen, die Mobilität einsparen, der Boom des Online- Handels. Andere Auswirkungen treffen unterschiedlich hart: ein Lockdown im Haus mit Garten wird anders erlebt als in beengten Verhältnissen. Das soziale Leben wurde erschüttert, incl. der damit verbundenen Branchen: Kunst und Kultur in ihren Live- Events, Gastronomie, Tourismus.
Übereinstimmung herrscht in zwei Punkten: 1. Die Klimakrise war zwar zwischenzeitlich in den Hintergrund gedrängt, wird aber das beherrschende Thema der Post–Corona–Zeit sein. 2. Die Veränderung der Arbeitswelt ist durch Corona beschleunigt worden. Hier wird sich eine Neue Normalität einstellen. — Bildung, Klima und Nachhaltigkeit, Soziale Gerechtigkeit, Partizipation, aber auch Deutschlands geopolitische Rolle werden als vordringliche Themen eines öffentlichen Zukunftsdiskurses genannt. Soweit ein zusammenfassender Einblick, mehr im Ergebnisdokument CoronaStresstest 2 .
 Armin Nassehi war als Mitglied der Leopoldina-Expertengruppe während der Pandemie der wohl medienpräsenteste Soziologe und äusserte sich in verschiedenen Phasen der Krise dazu, wie Corona unsere Gesellschaft verändert. Seine Positonen standen immer wieder im Gegensatz zu den Haltungen, die in der Krise die Chance zur Veränderung sehen: «Gesellschaften sind träge, sie ändern sich in und nach Katastrophen nicht grundlegend. Die Routinen werden sehr schnell wiederkommen, wenn diese Krise vorbei oder zumindest leichter beherrschbar ist» meinte er im April 20 in der NZZ – und das trifft seine Haltung ziemlich gut.
Armin Nassehi war als Mitglied der Leopoldina-Expertengruppe während der Pandemie der wohl medienpräsenteste Soziologe und äusserte sich in verschiedenen Phasen der Krise dazu, wie Corona unsere Gesellschaft verändert. Seine Positonen standen immer wieder im Gegensatz zu den Haltungen, die in der Krise die Chance zur Veränderung sehen: «Gesellschaften sind träge, sie ändern sich in und nach Katastrophen nicht grundlegend. Die Routinen werden sehr schnell wiederkommen, wenn diese Krise vorbei oder zumindest leichter beherrschbar ist» meinte er im April 20 in der NZZ – und das trifft seine Haltung ziemlich gut.
In seinem neuen Buch Unbehagen- Theorie der überforderten Gesellschaft (9/21) ist die Pandemie nicht direkt das Thema, sondern neben der Klimakrise – aufs allgemeingültige herausgehoben – Referenzkrise. Nassehis Blick darauf ist theoriegeleitet, das heisst bei ihm systemtheoretisch. Der Gegensatz Sachdimension vs Sozialdimension (vgl. 106-109) zieht sich durch die Argumentationen. Die Sozialdimension erzeugt eine Art Überzeitigkeit des Gemeinsamen, die Sachdimension eine Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem (123). Sozialdimension beschreibt Gesellschaft als integrierte oder integrierbare Einheit von Kollektiven, ihre Öffentlichkeit als Arena aufeinandertreffender Strömungen. Ordnungsaufbau findet über die Sachdimension statt, dem System unterschiedlicher sachlicher Bedürfnisse und Interessen, der Eigendynamik der Funktionssysteme Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Recht und zahlreichen anderen Teilbereichen der Gesellschaft. Funktionssysteme reagieren entsprechend ihrer eigenen Logik.
Nassehis grundlegendes Thema ist die Frage, warum Gesellschaften darin scheitern, wenn sie sich kollektiv verändern wollen. Die Eigendynamiken von technisch aufgerüstetem Wirtschaftssystem, auf Gleichheitsversprechen und Inklusion ausgerichtetem Rechtssystem, flächendeckendem Bildungssystem, das sowohl ungleiche Positionen zuweist als auch Aufstiegschancen moderieren kann, Mediensystem etc. entzieht sich zentraler Koordination (312). In der Gesellschaft bilden sich Handlungsmöglichkeiten daraus.
Krisen unterbrechen den Ablauf des Gewohnten, es gibt für sie keine Routinen. Krisen sind disruptiv, gesellschaftliche Veränderung verläuft aber evolutionär. Zu erreichen ist sie über die Veränderung von Organisationsroutinen.
Nassehis Buch enthält zahllose Beobachtungen, Beschreibungen und Detailanalysen, und auch einige abschliessende Erfahrungen, die Erkenntnisse in der (Post-) Corona- Diskussion vermitteln, aber es ist sicher nicht lösungsorientiert im Sinne eines Transformativen Zukunftsdiskurses. Das war aber auch von vornherein klar.
 In der ersten Phase der Pandemie beeindruckte v.a. die Akzeptanz und das Tempo der Durchsetzung von Home-Office und digitaler Kommunikation. Home Office setzte den Pendlercircuit zumindest temporär aus – damit einen bedeutenden Teil des Mobilitätsaufkommens. Die Graphik links zeigt eindrucksvoll den steilen Rückgang im Frühjahr 2020. Ein Ereignis gesellschaftlicher (incl. staatlicher) Einhelligkeit. Die späteren Lockdowns im Winterhalbjahr 20/21 bilden sich deutlich schwächer ab – sie pendelten sich spätestens in der zweiten Hälfte des Sommers 2021 wieder auf das Niveau der Zeit vor Corona ein. Etwas anders entwickelte sich die Mobilität auf kürzeren Distanzen (<5km) die bis dahin weniger zurückgegangen war.
In der ersten Phase der Pandemie beeindruckte v.a. die Akzeptanz und das Tempo der Durchsetzung von Home-Office und digitaler Kommunikation. Home Office setzte den Pendlercircuit zumindest temporär aus – damit einen bedeutenden Teil des Mobilitätsaufkommens. Die Graphik links zeigt eindrucksvoll den steilen Rückgang im Frühjahr 2020. Ein Ereignis gesellschaftlicher (incl. staatlicher) Einhelligkeit. Die späteren Lockdowns im Winterhalbjahr 20/21 bilden sich deutlich schwächer ab – sie pendelten sich spätestens in der zweiten Hälfte des Sommers 2021 wieder auf das Niveau der Zeit vor Corona ein. Etwas anders entwickelte sich die Mobilität auf kürzeren Distanzen (<5km) die bis dahin weniger zurückgegangen war.
 Noch deutlicher lässt sich dieselbe Entwicklung an der nebenstehenden Übersicht zum Verkehr auf Autobahnen sehen: Der markante (disruptive?) Knick im April 20, die leichte Abschwächung zum Jahresende und die Annäherung an die Prä- Covid Ära bis zum Sommer 2021.
Noch deutlicher lässt sich dieselbe Entwicklung an der nebenstehenden Übersicht zum Verkehr auf Autobahnen sehen: Der markante (disruptive?) Knick im April 20, die leichte Abschwächung zum Jahresende und die Annäherung an die Prä- Covid Ära bis zum Sommer 2021.
V.a. am Rückgang der Pendlermobilität und den Möglichkeiten der dezentralen Arbeit/Remote Office hatten sich Erwartungen eines mit der Krise beschleunigenden Wandels festgemacht. Entsprechend enttäuschend wird diese Entwicklung wahrgenommen, gesellschaftliche Lernschleifen werden nicht gesehen. Reaktionen auf die Pandemie allein machen keine Transformation, das Modell des örtlich (und zeitlich) gebundenen Arbeitsplatzes mit Pendelverkehr bleibt bestehen. Ein wesentlicher Schlüssel zu einer Verkehrswende liegt in der Arbeitsorganisation.
Corona- Krise und Klimakrise werden zwar oft nebeneinander gestellt, unterscheiden sich aber grundlegend. Corona brach plötzlich in eine globalisierte, funktionsteilig organisierte Welt ein und man wusste wenig davon. Die Sachzusammenhänge der Klimakrise (+ Folgen der Zerstörung von Lebensräumen, wie das Artensterben) sind seit langem bekannt. Die Klimakrise ist menschengemachte Folge gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlich- industriellen Handelns und sie hat dystopisches Potential. Wenn man es so ausdrücken will: Entfesselte Funktionssysteme. Von einem Krisenmanagement ist zu erwarten, sie einzuschränken. Wie, ist die Aufgabe eines Transformativen Zukunftsdiskurses. Demokratische Gesellschaften sind nicht zu führen wie Organisationen.
Deutschland 2030+: Corona Stresstest 2 – Ergebnisse. – Armin Nassehi: Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft. 9/ 2021 384 S. –Interview mit Armin Nassehi: Wie verändert Corona unsere Gesellschaft? 12.07.21. Untere Graphiken aus: Statistisches Bundesamt: Mobilitätsindikatoren auf Basis von Mobilfunkdaten. und Bundesanstalt für Strassenwesen: Verkehrsbarometer: Monatliche Entwicklungen des Strassenverkehrs 2020/2021. Ifo- Institut: Home Office im Verlauf der Corona- Pandemie. Juli 2021—
Zu den Graphiken: (obere): Veränderung der Mobilität 1/20 bis 9/21 nach Distanz- nach Klick in voller Grösse auf neuer Seite. Quelle: Statistisches Bundesamt; (untere: Monatliche Entwicklungen des Straßenverkehrs auf Bundesfernstraßen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Verkehrsbarometer).