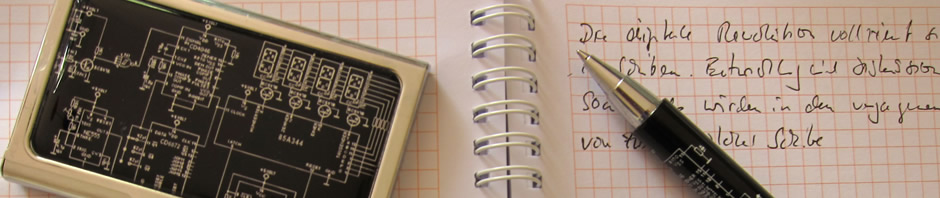Was war zuerst – technische Innovationen oder gesellschaftlicher Wandel? Die Wechselwirkung – Interdependenz – von Gesellschaft und Technik ist ein immer wiederkehrendes und zentrales Thema.
Dass Innovationen in Technik und Medien weitreichende, oft nicht voraussehbare, unabschätzbare Wirkungen haben, ist unbestritten. Historische Wendungen werden mit der Verbreitung neuer Techniken und Medien verbunden. So wird immer wieder gern erzählt, dass die Erfindung des Buchdrucks die Ausbreitung von Renaissance und Reformation erst ermöglicht hat.
Manche Entdeckungen versandeten aber auch ohne weitere Resonanz. Letztlich setzen sich Techniken nur dann durch, wenn sie ganz offensichtlich einen Nerv der Gesellschaft treffen (Nassehi).
Technik – materielle Zivilisation – ist integraler Bestandteil von Gesellschaften. Ihre Nutzung macht Gesellschaft erst zu einer solchen. Man könnte schon mit dem Faustkeil anfangen, spätestens seit dem Neolithikum, mit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht, Keramik, Textilherstellung und Hausbau, leben Menschen in einer menschengemachten Umgebung, deren Fortbestand und Weiterentwicklung von der Beherrschung der entwickelten Techniken abhängt. Innovative Sprünge mit weitreichenden Folgen gab es immer wieder in der Historie*.
Technik ist nicht nur menschengemachte Umwelt einer Gesellschaft, sie ist auch konstitutiv für die Entstehung, Gestaltung und Erhaltung gesellschaftlicher Formen.
Technikgeneseforschung klingt schon fast wie Technogenese. Sie befasst sich mit der gesellschaftlichen Konstruktion von Techniken, den Entstehungsbedingungen von Innovationen. Frage ist, welche gesellschaftlichen ‚Logiken’ und strategischen Akteure beobachtet werden können, die die technische Entwicklung mit ihren Ressourcen organisieren und in ihrer Richtung orientieren? (Rammert 2006) Vorherrschend sind ökonomische, politische und kulturelle Logiken, oft miteinander vermengt. Anschauliches Beispiel wäre etwa die Geschichte der Elektromobilität: Gleichzeitig mit dem Verbrennungsmotor entwickelt, dann in Nischen verdrängt. Der Ausbau der Infrastruktur folgte dem einmal durchgesetzten Pfad des Verbrennungsmotors – bis dann wieder Elektromobilität gesellschaftlich erwünscht ist und mit staatlicher Förderung angeschoben wird – alle drei genannten Logiken sind zu erkennen.
Technikdeterminismus sieht eindeutig Technik als den Motor des Geschehens an. Eine Sichtweise, die heute als überholt gilt, in den 50er und 60er Jahren aber dominant war. Grob: die Beherrschung komplexer Technik in der maschinenbasierten Großindustrie setzte Regeln und forderte Anpassung. Sachzwänge dienten der Legitimation, mit Auswirkungen auf das politische Handeln und die gesellschaftliche Wirklichkeit. Damit verbunden war eine eher statische, funktionale Vorstellung von Gesellschaft. Modernisierung bedeutete die Ausrichtung an den Erfordernissen technischen Fortschritts. Der gelegentlich auftauchende, von Industrie 4.0 abgeleitete Begriff Gesellschaft 4.0 spiegelt noch diese Haltung.
Die These des „cultural lag“ (W. Ogburn,1937) – die kulturelle Phasenverschiebung in der Adaption neuer Techniken, bedeutet einen abgeschwächten Technikdeterminismus. Gesellschaftlich/kultureller Wandel in Institutionen und Werten hängt demnach der technischen Innovation hinterher (vgl. Remmert, 2006).
Technikfolgenabschätzung geht im Ursprung darauf zurück, hat sich aber seitdem weit ausdifferenziert und dient der Abschätzung von Risiken und Nebenwirkungen, v.a. in der Politikberatung.
 Digitale Techniken verändern Wirtschaft und Gesellschaft so schnell wie zuvor noch keine andere technische Revolution – ein Satz, wie er so oder so immer wieder gesagt wird. Manchmal heisst es zudem, Digitalisierung treibe gesellschaftliche Verhältnisse vor sich her.
Digitale Techniken verändern Wirtschaft und Gesellschaft so schnell wie zuvor noch keine andere technische Revolution – ein Satz, wie er so oder so immer wieder gesagt wird. Manchmal heisst es zudem, Digitalisierung treibe gesellschaftliche Verhältnisse vor sich her.
Der Prozess der Digitalisierung ist allerdings kein einheitlicher Prozess, er verläuft nicht nach einheitlicher Logik. Zwar wurde/wird Digitalisierung in vielen Fällen zentral durchgesetzt, ihr Erfolg gründet sich aber in der breiten Akzeptanz in der Lebenswelt – man denke zurück an all die Stufen der Verbreitung: Textverarbeitung und Desktop- Publishing, Digitalphotographie, E-Mail, Musik u.v.m. – all diese Anwendungen erreichten eine schnelle und breite Resonanz in Arbeits- und Lebenswelt.
Ganz sicher ist die Durchsetzung an den Ausbau der Infrastrukturen gebunden: Kabelnetze, 3G, 4G, 5G Mobilfunknetze, Speichermöglichkeiten intern und in der Cloud, verbesserte Rechenleistungen etc. Jede Steigerung von Schnelligkeit und Volumen erweitert die Möglichkeiten, erleichtert neue Formen der Arbeitsorganisation und bedingt letztlich Veränderungen von Berufs-, Branchen- Beschäftigungsstrukturen – und Lebensentwürfen.
In Die Macht der Plattformen bezieht sich Michael Seemann auf das Konzept der Affordanz (16), das er als einen abgeschwächten Technikdeterminismus einordnet: Technik gibt nicht die Struktur vor, aber sie ermöglicht sie bzw. macht sie wahrscheinlich. Affordance Theory meint zunächst den Gebrauch von Angeboten in der unmittelbaren Umgebung, etwa einen Tisch im Strassencafé, eine Parkmöglichkeit in der Wohnstrasse oder eben die Nutzung technischer Möglichkeiten. Objekte haben einen Angebotscharakter und legen einen bestimmten Gebrauch nahe. Der Erfolg der GAFAM- Unternehmen ist damit gut zu erklären: Googles Suchergebnisse, das bruchlose Einkaufserlebnis bei Amazon, die Einfachheit, Convenience der Vernetzung bei Facebook sind Angebote, die bei aller oft in Diskussionen geäusserten Skepsis von Nutzern/Kunden angenommen werden.
Technogenese/Technogenesis bedeutet die parallele Entwicklung, die Co- Evolution von Technik und Gesellschaft. Evolution ist generell keine beabsichtigte Entwicklung. Der Begriff stammt von dem französischen Medientheoretiker Bernard Stiegler (✝2020) in Anlehnung an Anthropogenese.
Genauso offensichtlich klingt Technogenese an die Konzepte Sozio– und Psychogenese bei Norbert Elias an. Geht es dort um langfristige Wandlungen von Gesellschafts – und Persönlichkeitsstrukturen, um die Herausbildung eines Habitus, kann man Technogenese als Herausformung der jeweils spezifischen technischen/materiellen Zivilisation verstehen.
Technogenese richtet den Blick auf die Interdependenz technischer und gesellschaftlicher Entwicklung. Im Forschungskontext Netnographie wurde Technogenese seit 2015 aufgegriffen. 2019 im Essential Guide to Qualitative Social Media Research (116) als ontologische Grundlage von Netnographie bezeichnet. Technogenese ist ein Schlüsselbegriff für die Verbundenheit gesellschaflicher, medialer und technischer Entwicklung – der so auch Social Media in die Perspektive historischer Prozesse stellt. Eine Assemblage menschlich/technisch/medialer Umgebung. Derzeit als digitaler Konsumkapitalismus beschreibbar – der an einer Richtungsänderung steht.
Digitale Lebenswelt bedeutet eine fortwährende Adaption neuer Techniken, Dienste und Produkte. Zivilisation evolviert mit ihrer technischen Ausstattung. Politische, ökonomische und kulturelle Chancen sind damit verbunden. Technische Neuerungen können oft das freisetzen, was in einer Gesellschaft längst vorhanden ist.
Parallel zur Digitalen Transformation wird die kulturelle Transformation von der industriellen Moderne zur postindustriellen Spätmoderne diskutiert. Wahrscheinlich ist es v.a. die Feinstruktur der Digitalität, die sie an die Prozesse der Individualisierung anschliesst und von der vorhergenden unterscheidet: so etwa die Adressierbarkeit jede/s/r einzelnen im Gegensatz zur Ansprache über Massenmedien.
Kozinets, Robert V.: Netnography Redefined. SAGE Publications Ltd; Second Edition edition (July 24, 2015), S. 49 ff – Netnography. The Essential Guide to Qualitative Social Media Research.. Third Edition 2020, S. 113 ff. Niklas Luhmann: Gesellschaft der Gesellschaften, Kap. IX. Technik, S. 235 ff Michael Seemann: Die Macht der Plattformen. Politik in Zeiten der Internetgiganten,
Werner Rammert. Technik, Handeln und Sozialstruktur: Eine Einführung in die Soziologie der Technik. 2006
*Ein Beispiel von vielen: Neue Techniken der Schiffskonstruktion brachten Stämmen am europäischen Rand, den Wikingern, einen Vorsprung, den sie militärisch (d.h. plündernd) und im Ausbau eines Handelsnetzes über bis dahin kaum verbundene Weiten, nutzten.