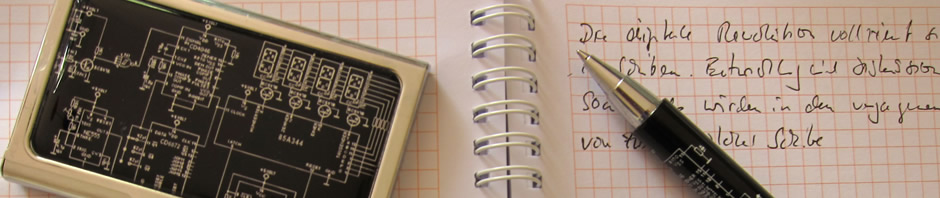Befasst man sich mit dem Thema Netnographie, stösst man bald auf eine tribale Metapher – und das gleich zweimal. Naheliegend beim Begriff Netnographie selber – zu schön ist die Geschichte der Entwicklung der ethnographischen Methode: Zuerst ist da der Forscher aus dem Kolonialzeitalter mit Tropenhelm und Kniebundhose (Bronislaw Malinowski, der Begründer der ethnographischen Feldforschung, bei den Trobriandern), der Rituale und Sinnbezüge fremder Ethnien ergründet. Später folgt die soziologische Ethnographie, die sich auf Teilkulturen der eigenen Gesellschaft richtet: beginnend mit der Street Corner Society in den 30er Jahren; als lebensweltliche Ethnographie auf besondere Szenen bzw. Milieus gerichtet, wie etwa Heimwerker, Skinheads, Sadomasochisten oder auch auf Betriebskulturen.
Von dort ist es dann nicht weit zur Netnographie, der Ethnographie im Kulturraum Internet, der allen erdenklichen Teilkulturen und Teilöffentlichkeiten eine Plattform bietet.
Eine neuere Form ist Fokussierte Ethnographie, die sich auf besondere Ausschnitte einzelner Teilkulturen konzentriert, durchgeführt meist mit audiovisueller Aufzeichnung. Sie wird häufig in der Marktforschung, bei der Produktentwicklung und zu evaluativen Zwecken eingesetzt. Es geht darum, Konsumenten oder z. B. Nutzer von Technik, in ihrem alltäglichen Kontext und in ihren Handlungsroutinen zu beobachten. Vom namensgebenden Feld des ἔθνος hat sich die Methode Ethnographie aber weit entfernt.
So verschieden die Felder sein mögen und so unterschiedlich das Forschungsinteresse, allen Spielarten sind einige methodische Grundlagen gemeinsam: Ethnographie forscht im natural setting, und nicht in einer zu Forschungszwecken konstruierten Umgebung, sie geht zumeist induktiv vor, d.h. theoretische Schlüsse werden aus dem Forschungsprozess heraus entwickelt. Teilnehmende Beobachtung ist zwar die bekannteste Methode, aber nicht zwingend, nicht-teilnehmende Beobachtung in vielen Fällen sinnvoll (mit besonderen Implikationen der Forschungsethik), grundsätzlich gilt “…the ethnographer participates, overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, watching what happens, listening to what is said, asking questions; in fact collecting whatever data are available to throw light on the issues with which he or she is concerned.” (Atkinson & Hammersley 1983, S. 2).
Ihren zweiten Auftritt hat die tribale Metapher mit dem Konzept der Tribus Urbaines/Urban Tribes von Michel Maffesoli (Le Temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse. Paris, 1988). Damit waren zunächst Vergemeinschaftungen in Subkulturen abseits des Mainstream gemeint. Maffesoli verstand Punks als typisches Beispiel eines Urban Tribe. Postmoderne metropolitane Stämme werden als Netzwerke oft sehr heterogener Personen definiert, die durch eine gemeinsame Passion oder Emotion miteinander verbunden sind, es geht um die gefühlte Gemeinschaft. Im Unterschied zum traditionellen Stammesbegriff sind postmoderne Stämme nicht exklusiv: Jeder einzelne kann gleichzeitig mehreren angehören. Meist zeichnen sie sich durch eine gemeinsame Ästhetik aus. Beispiele sind Fan- und Subkulturen mit eigenen sozialen Normen und Ritualen, Lebensstilen und Loyalitäten. Insbesondere in den angelsächsischen Ländern wurden Maffesolis Thesen zum Neo-Tribalismus breit rezipiert und gelten als wichtiger Beitrag zu den Cultural Studies.
Auch ins Marketing fand das Konzept seinen Weg: Tribal Marketing zielt darauf ab, Brand Communities rund um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bilden. Grundannahme des Tribal Marketing ist es, dass postmoderne Konsumenten Produkte und Dienstleistungen bevorzugen, die sie mit anderen Menschen verbinden, zu einer Community, zu einem Tribe (vgl. Rezension zu Consumer Tribes).
So nützlich und brauchbar das Konzept der Urban Tribes erscheint, anders als der Anglizismus tribal sperrt sich zumindest der Stammesbegriff in der deutschen Sprache gegen seine Erweiterung. Ist die Stammesmetapher etwa bei (klassischen) Punks mit – damals – neuer Ästhetik und eigenen kulturellen Codes noch leicht nachvollziehbar, wird es schwieriger sie auf Fashion Victims, Nerds oder etwa FairTrade-Konsumenten anzuwenden.
Was macht die Stammesmetapher so attraktiv? Stämme sind archaisch, man versteht darunter Gesellschaften, deren Bindungen untereinander auf gemeinsame Abstammung, zumindest aber auf kulturelle Rituale, Mythologien und Initiationen gegründet sind. Es sind vormoderne oder vorstaatliche Gesellschaften, die auf direkten sozialen Beziehungen beruhen und nur indirekt staatlicher Kontrolle unterworfen sind – höchstens noch bei einigen indigenen Völkern zu finden und oftmals Objekte von Romantisierung. Realiter kaum noch zu finden, weckt sie Bedürfnisse nach Authentizität und gefühlter Gemeinschaft. Wendet man Urban Tribes auf zeitgenössische Vergemeinschaftungen im Internet an, gelangt man zu dem, was bereits Marshall McLuhan Clusters of Affiliation nannte. Eine griffigere Bezeichnung dazu ist noch vakant.