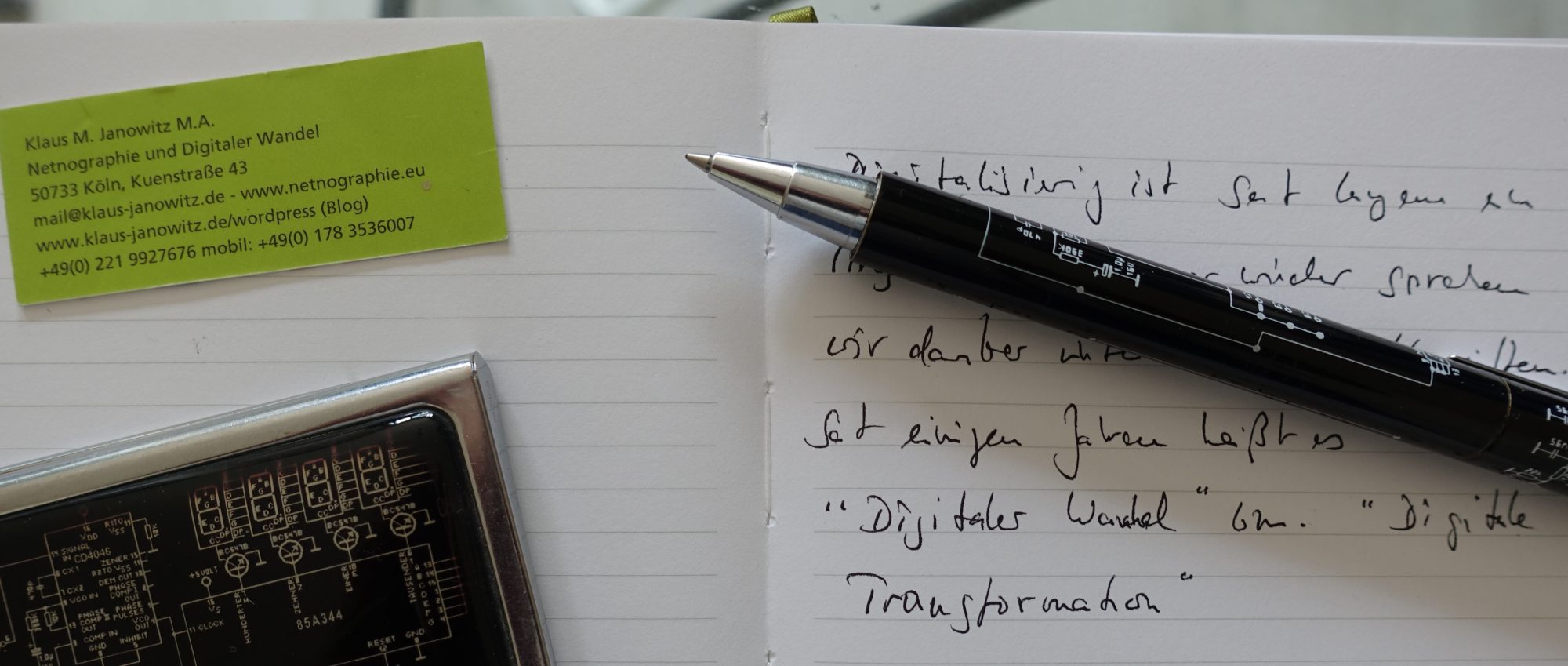Wohlstand für alle, war der Titel eines Buches von Ludwig Erhardt (1957), und es war eine Maxime der Sozialen Marktwirtschaft – gesellschaftlicher Konsens und Grundübereinkunft darüber, wie die Wirtschaft sein sollte (29). Prinzipien wie Sozialpartnerschaft leiten sich daraus her. Auf diesen Versprechen beruhte zunächst die Identifikation mit der demokratischen Bundesrepublik, Nation Building der 50er Jahre.
Wohlstand für alle, war der Titel eines Buches von Ludwig Erhardt (1957), und es war eine Maxime der Sozialen Marktwirtschaft – gesellschaftlicher Konsens und Grundübereinkunft darüber, wie die Wirtschaft sein sollte (29). Prinzipien wie Sozialpartnerschaft leiten sich daraus her. Auf diesen Versprechen beruhte zunächst die Identifikation mit der demokratischen Bundesrepublik, Nation Building der 50er Jahre.
Solange die Marktkräfte Wohlstand mehren, lässt der Staat sie wirken. Seine Aufgabe ist es, mit einer strikten Wettbewerbspolitik ordnungspolitische Leitplanken zu setzen, um Monopole, Kartelle und andere Fehlentwicklungen zu verhindern. Auf den digitalen Märkten gelten andere Regeln als früher. Den Autoren Achim Wambach (Präsident Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim) und Hans- Christian Müller (Redakteur Handelsblatt) geht es um die Bewahrung des erfolgreichen und identitätsstiftenden Modells der Sozialen Marktwirtschaft in der digitalen Wirtschaft. Ein Update, nicht auf 4.0, aber zur Neuaufstellung “der guten Wirtschaftsordnung” (13). Wettbewerbspolitik spielt dabei ebenso wie Bildungs- und Sozialpolitik eine entscheidende Rolle. Weiterer wesentlicher Punkt ist Steuergerechtigkeit, die die Digitalkonzerne einschliesst. Multinationale Konzerne haben darin Expertise gewonnen, nationale Steuersysteme gegeneinander auszuspielen.
Daten statt Preise, Monopole statt Wettbewerb, Sharing statt Eigentum, Crowdworking statt Sozialpartnerschaft (24-28) – mit diesen Gegensatzpaaren wird die Digitalwirtschaft charakterisiert. Insbesondere Märkte für datenbasierte Internetdienstleistungen neigen zu Monopolen. Die Machtfülle der Internetkonzerne, der “Grossen Fünf” (Microsoft ist wieder dabei) beruht darauf. Der Markt ist nahezu in die jeweiligen Kerngeschäfte + einige Überlappungen aufgeteilt. Dazu kommen Dienste der Sharing- Ökonomie, die vormals keine Marktbeziehungen waren. Ein Begriff kommt im Text nicht vor: Verhaltensüberschuss, auf dessen Entdeckung der Erfolg der Datenwirtschaft beruht – (ausführlich beschrieben bei Shoshana Zuboff).
Die Sorge um Verlust von Erwerbsarbeit durch Automatisierung teilen die Autoren nicht. Nicht mehr geben wird es zehntausende Jobs bzw Stellen mit gleichem Tätigkeitsprofil (134). Aufgabe des Staates ist es, den Strukturwandel mit Wettbewerbs-, Sozial- und Bildungspolitik zu gestalten, um eine Spaltung in neue Gewinner und Verlierer zu verhindern (142).
Neben die immer wiederkehrenden Verweise auf Wettbewerbs- bzw. Ordnungspolitik treten einzelne konkrete Vorschläge, wie etwa die (hohen) Mindestbeiträge für Selbständige in der Kranken- und Pflegeversicherung zu senken (136/137). Freiberufler sollen in der sozialen Absicherung keine Nachteile davon haben, dass sie als Selbständige arbeiten.
Das Buch ist sehr übersichtlich, liest sich flüssig und eingängig und wurde mehrfach als vorzüglich und profund hervorgehoben. Gliederung und Register machen es leicht im Text vor- und zurückzuspulen, 222 Seiten bedeuten keinen allzu grossen Zeitaufwand. Man hat immer wieder den Eindruck – wenn’s denn weiter nichts ist, als mit Wettbewerbs- und Kartellrecht der Internetwirtschaft Grenzen zu setzen – dann aber los! Autor Wambach ist zudem Präsident der Monopolkommission, die das Bundeswirtschaftsministerium in Wettbewerbsfragen berät. Dazu passt der programmatische Stil, der manchmal an politische Grundsatzerklärungen erinnert.
Mittendrin beim Schreiben dieses Beitrags kam passenderweise die Nachricht von der Entscheidung des Bundeskartellamtes zu Facebook, WhatsApp und instagram: Wir nehmen bei Facebook für die Zukunft eine Art innere Entflechtung bei den Daten vor …. Die Kombination von Datenquellen hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass Facebook einen so einzigartigen Gesamtdatenbestand über jeden einzelnen Nutzer erstellen und seine Marktmacht erreichen konnte. (A. Mundt, Präs. Bundeskartellamt). Der Zusammenhang mit den im Buch vertretenen Positionen wird in einem Interview im Tagesspiegel nochmals deutlich. Inwieweit, zumindest in der Wettbewerbspolitik die Politik des BMWi davon beeinflusst ist, bleibt abzuschätzen.
Ein Gedanke: Man sollte das Update der Sozialen Marktwirtschaft mit den von D2030 formulierten Szenarios abgleichen: Wieviel an Neuen Horizonten und Spielraum der Zivilgesellschaft, wieviel Renaissance der Politik oder auch wieviel Regulierung und Leitkultur (Ludwig Erhardt?) steckt darin?
 Warum jetzt zwei Bücher verschiedener Autoren in einer Besprechung? In beiden Büchern geht es um die Rolle des Staates als Setzers von Regeln in der Digitalwirtschaft. Beide Bücher kommen aus dem Inneren des politischen Systems bzw. der Ministerialverwaltung.
Warum jetzt zwei Bücher verschiedener Autoren in einer Besprechung? In beiden Büchern geht es um die Rolle des Staates als Setzers von Regeln in der Digitalwirtschaft. Beide Bücher kommen aus dem Inneren des politischen Systems bzw. der Ministerialverwaltung.
In “Digitaler Wohlstand für alle” wird Wettbewerbspolitik als staatliche Maßnahme zur Korrektur der Digitalwirtschaft selbstbewusst in den Vordergrund gestellt. In “Schwacher Staat im Netz” geht es um die Frage, ob dieser Staat überhaupt in der Lage ist, den Rahmen einer Digitalen Gesellschaft zu setzen. Dazu ein kurzer Überblick.
Autor Martin Schallbruch war lange Jahre im BMI für Informationstechnik und Cybersicherheit zuständig. Der Einstieg: Die Digitalisierung fordert den Staat nicht einfach nur heraus. Sie überfordert ihn. Sie stellt in Frage, wie wir 70 Jahre lang unser Gemeinwesen gesteuert, organisiert und verteidigt haben (2). Generell ist es Aufgabe des Staates vernünftige, praktisch taugliche Regeln der Verantwortungszuweisung bereitzustellen (193).
Es steht auf dem Spiel, dass der demokratisch konstituierte Staat das Setzen und Kontrollieren von Regeln Plattformen überlässt.
Seine Überlegungen führen schliesslich zu einer Definition übergeordneter Ziele (220- 224): Nachvollziehbarkeit darüber wer welche Verantwortung trägt und welches Recht wann für wen gilt. Ein definierter Versorgungsauftrag, das bedeutet, was wäre etwa der digitale Versorgungs- (bzw. Bereitstellungs-) auftrag im Gesundheitswesen, in der Kultur, oder für die Mobilität? Schließlich Digitale Souveränität in der Bedeutung, dass der Staat im digitalen Raum die wesentlichen Problemstellungen des digitalisierten Gemeinwesens versteht, im Rahmen eines politischen und rechtlichen Auftrags adressiert und diese auch durchsetzt. Um sich daraus ergebende Aufgaben zu erfüllen ist ein entsprechendes Know- How, genauso umfassend wie bei den Digitalunternehmen, Voraussetzung.
Schallbruch ist für einen “starken Staat im Netz” – und damit meint er einen, der den genannten Aufgaben gerecht wird. Um diese zu gewährleisten befürwortet er ein Digitalministerium. Digitalpolitik ist nicht Fachpolitik, sondern in den Querschnittsfunktionen vergleichbar der Finanz- oder Justizpolitik für Geld und Recht (246). Zur Agenda eines Digitalministeriums gehört mehr als Breitband und StartUp Förderung, ganz oben: Digitalrecht, Versorgungsauftrag und übergeordnet eine digitale Gesamtarchitektur (246).
Achim Wambach & Hans- Christian Müller: Digitaler Wohlstand für alle. Ein Update der Sozialen Marktwirtschaft ist möglich. Campus Verlag, Frankfurt 2018, ISBN: 978-3-593-50929-7 220 S., 28 € Martin Schallbruch: Schwacher Staat im Netz. Wie die Digitalisierung den Staat in Frage stellt. Springer, Wiesbaden, 2018. ISBN: 978-3-19946-3 271 S. , 19,95 €. Interview mit Achim Wambach: Die Facebook-User haben keine Alternative – Der Tagesspiegel. 8.02.2019 (Heike Jahberg)